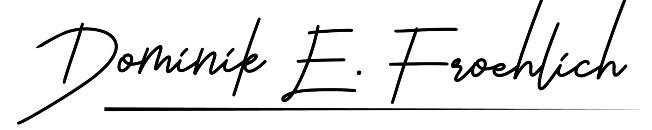Du drehst dich seit Tagen oder Wochen im Kreis, weil du einfach keine gute Forschungsfrage findest? Dir fehlt die zündende Idee für die richtige Fragestellung?
Keine Sorge – Du bist nicht allein, denn vielen geht es genau wie dir:
- „Ich habe null Ahnung, was ich überhaupt fragen soll.“
- „Ich fange immer wieder an, aber komme keinen Schritt weiter.“
- „Ich hab das Gefühl, ich steh komplett im Nebel.“
Die gute Nachricht: Eine gute Forschungsfrage zu formulieren ist kein Hexenwerk – wenn du die richtigen Schritte kennst. Genau dafür ist dieser Hub da.
Hier findest du alles, was du brauchst, um eine gute Forschungsfrage für deine Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Abschlussarbeit zu finden.
Du bekommst eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, praktische Beispiele und einen kostenlosen Onlinekurs, der dich von der ersten Idee bis zur ausformulierten Forschungsfrage begleitet.
Warum ist die Forschungsfrage so wichtig?
Die Forschungsfrage ist der Dreh- und Angelpunkt deiner Arbeit und gibt deiner wissenschaftlichen Arbeit Richtung und Struktur. Ohne sie fehlt der Kompass, was zu Unsicherheit und Überforderung führen kann.
Eine präzise Frage erleichtert die Literaturrecherche, Methodenauswahl und das Schreiben. Und genau das macht sie so schwer.
Deshalb ist es wichtig, die Forschungsfrage von Beginn an richtig einzugrenzen.
Was macht eine gute Forschungsfrage aus?
Um dir bei der Findung deiner Forschungsfrage zu helfen, haben wir eine wissenschaftlich fundierte Formel entwickelt, die dir systematisch dabei hilft, deine Fragestellung zielgerichtet zu formulieren.
Die Formel nennt sich MINERVA-Formel und ist nach der römischen Göttin der Weisheit benannt.
Jeder Punkt steht für ein Kriterium, welches du bei der Formulieren der Forschungsfrage beachten solltest.
M achbarkeit
I nteresse
N euheit
E thik
R elevanz
V erständlichkeit
A kurrat
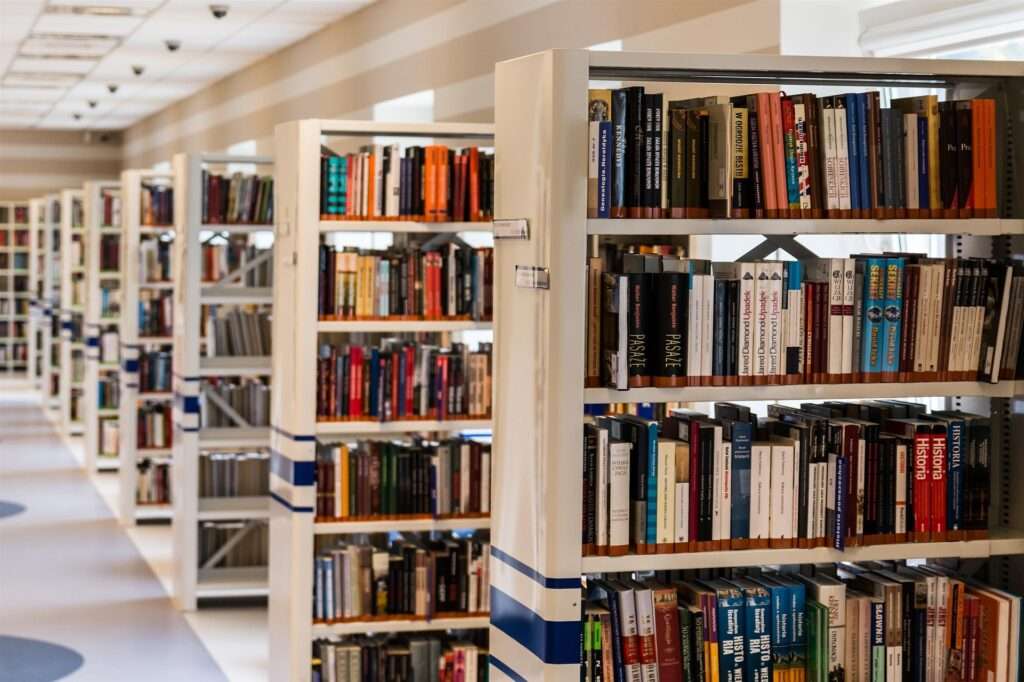
In 3 Schritten zur klaren Forschungsfrage
Schritt 1: Forschungsthema finden
Bevor du überhaupt an eine Forschungsfrage denkst, brauchst du ein klares Thema. Bei der Themenfindung geht es erstmal nicht um „Wissenschaftlichkeit“, sondern um Relevanz und Interesse. Die wissenschaftliche Schärfung kommt später erst dazu.
Statt also stundenlang zu Grübeln, Um tiefer in das Thema einzusteigen, schau dir gern unseren Artikel „Wie finde ich ein relevantes Thema für meine Bachelorarbeit?“ an.
Oder du beginnst mit einem einfachen Brainstorming und frage dich:
- Was hat dich in deinem Studium interessiert?
- Gibt es Themen, die dich im Alltag oder im Job beschäftigen?
- Was regt dich auf, was fasziniert dich?
- Was fehlt in der Wissenschaft?
Gerade die letzte Frage ist besonders wichtig, denn sie führt dich direkt zur Forschungslücke – dem Herzstück deiner Arbeit.
Welche Themenvorschläge sind gut?
Ein gutes Thema und eine intereessanre Forschungsfrage, hängt vor allem von dir und deinen Interessen ab.
Um dir trotzdem ein qualifiziertes Feedback zu deinen Themenvorschlag zu geben, haben wir eine KI-gestütze Lösung entwickelt, mit der wir genau dieses Problem lösen.
Das Tool bietet dir nicht nur eine erste Einschätzung, sondern liefert auch hilfreiche Hinweise zur Verbesserung.
Für eine ausführlichere Betrachtung haben wir das Thema in unterschiedlichen akademischen Disziplinen für dich beleuchtet und einen KI-Bot erzeugt, der dir bei Brainstormen in bestimmten Fachrichtungen, wie z.B. Wirtschaftspsychologie & Arbeitspsychologie, Bildungswissenschaft, Innovation Management oder Exekutive Management.
Schritt 2: Forschungsfrage finden und entwerfen
Jetzt wird es konkret. Du hast ein Thema, aber was willst du genau wissen? Hier beginnt der Kern deiner wissenschaftlichen Arbeit – Das Formulieren einer Forschungsfrage.
So gehst du vor:
- Überleg dir: Was ist das ungelöste Problem in deinem Thema?
- Willst du etwas erklären, vergleichen, verstehen?
- Was ist wirklich forschbar – also mit deinen Mitteln in deiner Zeit machbar?
Am Anfang steht oft eine grobe Richtung. Zum Beispiel „Wie beeinflusst X das Verhalten von Y?“. Daraus kannst du dann eine präzise und prüfbare Forschungsfrage entwickeln.

Schritt 3: Forschungsfrage präzisieren
- Generalisieren und Konkretisieren: Passe den Fokus deiner Frage an, um ein ausgewogenes Maß an Spezifität zu erreichen.
- Dimensionen und Perspektiven variieren: Betrachte unterschiedliche Blickwinkel und Aspekte deines Themas.
- Flexibilität bewahren: Sei bereit, deine Forschungsfrage im Verlauf der Arbeit anzupassen.
Hier geht es insbesondere darum, die Hauptbegriffe deiner Forschungsfrage zu identifizieren und sie ggf. auf unterschiedlichen Ebenen der Granularität zu definieren.
Fazit
Ein Thema zu wählen und eine gute Forschungsfrage daraus zu entwickeln ist durchaus nicht leicht. Aber es ist wichtig. Sehr wichtig sogar, denn die Qualität der ganzen weiteren Arbeit hängt davon ab.
Du hast alle drei Schritte durchgearbeitet und brauchst Feedback?
Ein guter Gedanken, denn Forschung lebt immer von Austausch und unterschiedlichen Sichtweisen.
Hier hast du zwei Möglichkeiten für fundiertes Feedback: Unseren eigens programmierten und trainierten KI-Chat oder eine direkte Feedback-Session mit uns im Live-Call.
Häufige Fragen beim Formulieren einer Forschungsfrage
Ein Forschungsthema ist eher ein breites Feld oder ein Interessensgebiet – zum Beispiel „soziale Medien in der Bildung“ oder „Stressbewältigung bei Studierenden“.
Eine Forschungsfrage dagegen ist die präzise, fokussierte Fragestellung, die du in deiner Arbeit beantworten möchtest. Sie ist das Herzstück deiner wissenschaftlichen Untersuchung und gibt dem gesamten Projekt eine klare Richtung.
Anders gesagt: Das Thema ist der Rahmen, die Frage ist der konkrete Punkt, den du in den Fokus nimmst.
Die Forschungsfrage ist die Basis deiner Bachelor- oder Masterarbeit. Sie bestimmt, was du untersuchst, wie du es untersuchst und was du am Ende daraus ableiten kannst. Nur wenn du eine gute, durchdachte Frage stellst, wirst du auch in der Lage sein, eine sinnvolle und relevante Antwort zu finden – eine, die sowohl wissenschaftlich etwas beiträgt als auch dir selbst ein gutes Ergebnis ermöglicht. Eine schwache Frage führt oft zu einer diffusen Arbeit, eine starke Frage ist wie ein innerer Kompass.
Das lässt sich natürlich nicht pauschal sagen, denn es hängt stark vom Thema und von den Ressourcen ab, die dir zur Verfügung stehen (z. B. Zeit, Zugang zu Daten, Methodenkenntnisse). Aber: Studierende neigen erfahrungsgemäß dazu, ihre Fragen zu breit zu formulieren. Deshalb lohnt es sich fast immer, noch einmal weiter einzugrenzen, klarer zu werden, und vielleicht sogar Teilaspekte auszugrenzen. Dafür findest du auf dieser Seite auch hilfreiche Tools und Reflexionsfragen zur Feinspezifizierung deiner Frage.
Nicht jede interessante Frage ist automatisch auch eine gute wissenschaftliche Frage. Um als solche zu gelten, muss sie relevant, sinnvoll und mit den verfügbaren Methoden tatsächlich untersuchbar sein. Es braucht also einiges an Denkleistung und methodischem Feingefühl, um genau das zu formulieren, was sich in deiner Arbeit auch realistisch beantworten lässt. Dabei helfen dir auch die Minerva-Kriterien, die wir auf dieser Seite verlinkt haben – sie geben dir eine gute Orientierung für die Qualität deiner Fragestellung.
Das ist eine sehr häufige und wichtige Frage, die viele Studierende anfangs beschäftigt. Denn ohne ein tragfähiges Thema fällt alles Weitere schwer. Genau dafür habe ich einen eigenen Online-Kurs entwickelt, der dich Schritt für Schritt durch diesen Prozess führt. Den Link dazu findest du hier auf der Seite. Wichtig ist: Lass dich nicht vom „perfekten Thema“ lähmen – es geht nicht um das eine beste Thema, sondern um eines, mit dem du motiviert und produktiv arbeiten kannst.
Wenn du bereits ein Thema hast, geht es jetzt darum, konkreter zu werden. Das ist ein zentraler Schritt, den viele unterschätzen. Auch dazu habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der dich systematisch durch diesen Prozess begleitet. Alternativ kannst du dir auch direkt auf dieser Seite die Kriterien für eine gute Forschungsfrage ansehen – diese helfen dir, dein Thema Schritt für Schritt herunterzubrechen und präziser zu machen. Diese Arbeit lohnt sich!
Diese Einschätzung ist nicht immer ganz einfach, weil sie stark vom Gesamtzusammenhang abhängt: deiner Methode, deiner Zeitplanung, deinem Vorwissen. Deshalb findest du auf dieser Seite zwei Unterstützungsangebote: Einerseits kannst du unser KI-Tool nutzen, das dir eine erste Rückmeldung gibt, andererseits gibt es die Möglichkeit, Live-Feedback von unseren Coaches einzuholen. Beides hilft dir, deine Frage im Kontext zu reflektieren und gegebenenfalls nachzuschärfen.
Das passiert ziemlich oft – und mein Rat ist: Triff eine schnelle Entscheidung. Nicht überhastet, aber bewusst. Denn nur so kannst du wirklich fokussiert in den Arbeitsprozess starten. Wenn zwei Themen für dich gleichwertig sind, wähle eines aus und fang an. Nach einem Tag oder zwei wirst du merken, ob es passt. Falls nicht, kannst du immer noch auf die zweite Option umsteigen. Aber wenn du wechselst, dann bitte: Zieh’s durch und schau nicht zurück.
Das hängt stark vom Fachbereich ab. In manchen Disziplinen braucht es eine saubere theoretische Fundierung, in anderen steht die Praxis oder Empirie stärker im Vordergrund. Grundsätzlich ist es aber hilfreich, wenn du eine theoretische Perspektive zumindest mitdenkst. Manchmal reicht es schon, wenn du dir überlegst: „Wie würde Theorie XY dieses Thema betrachten?“ – Das kann dir helfen, deine Frage klarer und analytisch schärfer zu formulieren.
Das hängt stark davon ab, ob du eine explorative oder konfirmatorische Frage stellst. Explorative Fragen zielen auf Neuland und kommen gut damit aus, wenn wenig Literatur vorhanden ist. Konfirmatorische Fragen dagegen setzen meist auf bestehende Theorien, Modelle oder Messinstrumente auf. Überlege dir also: Wo im Forschungszyklus bewegt sich dein Thema? Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, empfehlen wir dir unseren Artikel dazu: Explorativ vs. Konfirmatorisch: Welcher Forschungsansatz passt zu deinem Thema?
Dann hast du vermutlich eine explorative Fragestellung – und das ist völlig in Ordnung. Gerade im Bachelor- oder Masterkontext ist es legitim (und oft sogar spannend), in eher unerforschte Felder vorzustoßen. In solchen Fällen wirst du tendenziell auf qualitative Methoden zurückgreifen, um erste Einblicke zu gewinnen. Wichtig ist nur: Du solltest trotzdem ein Mindestmaß an theoretischem oder thematischem Anschluss finden, um deine Arbeit zu verankern.
Das ist tatsächlich einfacher, als viele denken: Sprich mit Praktiker:innen! Schon ein kurzes, informelles Gespräch kann dir helfen zu verstehen, ob deine Frage im echten Leben einen Nerv trifft. Ich empfehle dir, im frühen Stadium ein oder zwei lose Interviews mit Expert:innen aus dem Feld zu führen. Das ist zwar optional, aber meiner Erfahrung nach extrem hilfreich, um das Praxispotenzial deiner Fragestellung besser einschätzen zu können.
Das Verhältnis zwischen Methode und Frage ist etwas tricky. Streng genommen solltest du zuerst die Forschungsfrage haben – denn diese gibt vor, was du wissen willst. Aber natürlich macht es Sinn, die Methode mitzudenken. Wenn du z. B. ein exploratives Thema hast, bietet sich oft eine qualitative Herangehensweise an. Wenn du hingegen etwas messen oder vergleichen willst, wirst du eher auf quantitative Verfahren setzen – und brauchst dann eine geschlossene, präzise formulierte Frage. Also: Die Methode sollte nicht alles vorgeben, aber sie sollte bei der Formulierung nicht völlig ignoriert werden.
Ein grobes Unterscheidungskriterium ist die Formulierung der Frage:
Qualitative Fragen sind eher offen – sie fragen nach „Wie?“ oder „Warum?“. Quantitative Fragen dagegen sind meist geschlossen und zielen auf Messbarkeit und Vergleichbarkeit ab. Wichtig: Nicht jede Frage lässt sich direkt in eine Methode übersetzen. Gerade bei quantitativen Vorhaben brauchst du in vielen Fällen einen Zwischenschritt, nämlich die Formulierung von Hypothesen, die aus deiner Forschungsfrage abgeleitet werden. Die Entscheidung für die Methode ist also oft ein Zusammenspiel aus inhaltlichem Fokus und praktischem Vorgehen.
Dann gilt ganz klar: Passe sie an. Es ist völlig normal, dass sich eine Forschungsfrage im Laufe der Arbeit weiterentwickelt. Du lernst dazu, deine Perspektive verändert sich, neue Erkenntnisse kommen dazu – und das darf sich in deiner Frage widerspiegeln. Wichtig ist nur: Bleib innerhalb des Rahmens deiner Arbeit. Es geht nicht darum, ständig alles umzuschmeißen, sondern darum, gezielt und begründet nachzuschärfen, wenn sich zeigt, dass die ursprüngliche Frage nicht tragfähig ist. Ein bewusster Umgang damit ist Teil des wissenschaftlichen Prozesses.
Feedback ist Gold wert, besonders wenn es aus unterschiedlichen Perspektiven kommt. Frag ruhig Freund:innen, Kommiliton:innen oder auch Praktiker:innen aus dem Feld. Auf dieser Seite hast du außerdem zwei Tools zur Verfügung: ein KI-Feedback-Tool, das dir erste Einschätzungen gibt, und die Möglichkeit für Live-Coaching, in dem wir gemeinsam deine Frage weiterentwickeln. Nutze diese Angebote – sie helfen dir, deine Frage wirklich zu finalisieren und zu fundieren.
Deine Forschungsfrage ist wie eine Visitenkarte deiner Arbeit. Wenn sie durchdacht, relevant und sauber formuliert ist, signalisiert das deinem Betreuer oder deiner Betreuerin: Du weißt, was du tust. Deshalb lohnt es sich, hier wirklich Zeit und Energie zu investieren. Eine gute Frage macht nicht nur Eindruck, sie erleichtert dir auch den gesamten weiteren Arbeitsprozess. Und natürlich solltest du dein Gegenüber auch aktiv um Feedback bitten – je früher, desto besser.