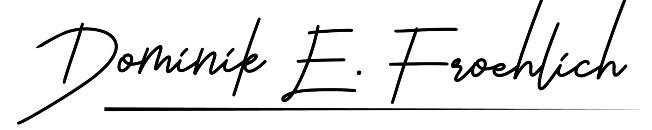In dieser Übung setzt du, alleine oder in einer Gruppe, ein kleines Übungsprojekt um, das die Anwendung von Inhalten der Basiskapitel über die deskriptive Statistik benötigt.
Wenn du eine interaktive Version mit direkter Eingabe deiner Antworten machen möchtest (ggf. zur späteren Nachbesprechung), kannst du diesen Mini-Kurs absolvieren.
Einleitung
Das in einem anwendungsorientierten Kontext zu wiederholen ist eine sehr wichtige Sache. Denn diese Inhalte sind es, die eigentlich immer vorausgesetzt werden — auch wenn man sie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wirklich „sehen“ kann. Wenn du einen wissenschaftlichen Artikel liest, zum Beispiel, musst du einfach davon ausgehen, dass Punkte wie Messung und Stichprobenziehung einfach gut erfüllt worden — du siehst es nicht direkt in den Daten bzw. Metriken, die der Artikel präsentiert.
Konkret geht es dabei um die inhalte der folgenden Beiträge:
- Relevanz von Statistik in der Psychologie und Arbeitpsychologie
- Der Aufbau der statistische Datentabelle
- Wichtige Begriffe
- Messung und Operationalisierung für die deskriptive Statistik
- Datenerhebung für die quantitative Forschung
- Stichprobe und Population in der Statistik
Aber lass uns das Schritt für Schritt durchgehen.
Schritt 1: Hypothese wählen
Wir steigen bei unserem Forschungsdesign bei der Hypothese ein (vorige Punkte wie Forschungsziele oder Forschungsfragen überspringen wir der Einfachheit halber in dieser Übung).
Denk dir eine Hypothese aus oder nimm eine dieser Beispielhypothesen. Alle weitere Schritte sollen sich dann auf die gewählte Hypothese beziehen:
- Mehr durchschnittliche Schlafdauer (letzte 7 Tage) geht mit höherer Konzentrationsfähigkeit beim Lernen einher.
- Häufigere Nutzung von Spaced-Repetition pro Woche steht in positivem Zusammenhang mit der letzten Quiz-Punktzahl.
- Lernen an einem ablenkungsarmen Ort führt zu längerer fokussierter Lernzeit pro Tag.
- Mehr Pomodoro-Sessions/Tag gehen mit geringerer subjektiver Prokrastination einher.
- Studierende, die in Gruppen lernen, berichten höhere Lernmotivation.
Output Schritt 1:
- Eine Hypothese.
Beispiel
Mehr durchschnittliche Schlafdauer (letzte 7 Tage) geht mit höherer Konzentrationsfähigkeit beim Lernen einher.
Schritt 2: Konstrukte bestimmen
Bestimme, welche Konstrukte in der Hypothese vorkommen und welche Rolle sie in der Hypothese einnehmen (Anders gesagt: Um welche „Art“ von Variable handelt es sich hier?). Recherchiere auch kurz eine Definition für diese Konstrukte und umreisse auch kurz, wieso es sinnvoll wäre, diese Hypothese zu testen (Relevanz).
Output Schritt 2:
- Eine Tabelle, die die Konstrukte benennt und definiert und ihre Rolle in der Hypothese beschreibt.
- Ein kurzes Statement zur Relevanz der Hypothese.
Beispiel
- Schlafdauer
- Definition: Tatsächliche Zeit pro Nacht (Mittagsschläfe zählen nicht mit), die schlafend verbracht wird (Netto-Schlafzeit)
- Rolle: unabhängige Variable; Notiz: die Hypothese ist ohne direkte Richtung formuliert. Wir entscheiden nun trotzdem, dass es eine bestimmte Richtung von Schlafdauer zu Konzentration gibt
- Konzentrationsfähigkeit
- Definition: Aufmerksamkeit, die im Rahmen eines Studientages von der Person werden kann.
- Rolle: abhängige Variable
- Relevanz: Konzentrationsfähigkeit als wichtiger Prädiktor im Rahmen des Studius; zusätzlich gesellschaftliches Phänomen, das Schlafdauer kontinuierlich sinkt. Hier gehen wir der Frage nach, inwiefern das ein Problem im Rahmen des Studiums ist.
Schritt 3: Operationalisierung
Nun geht es darum, die jeweiligen Konstrukte weiter runterzubrechen und messbar zu machen. Hier kannst du ggf. nochmal im entsprechenden Beitrag nachlesen, was bei der Messbarmachung von Konstrukten zu beachten ist (Messung und Operationalisierung für die deskriptive Statistik).
Was wir brauchen sind konkrete Fragen, die man stellen könnte. Diese kannst du durch eine Recherche bekommen (bestehende Skalen suchen) oder auch dadurch, dass du eigene Items erfindest. Zwei bis drei Items reichen vollkommen. Achtung: Das ganze ist natürlich nur vollständig, wenn du auch entsprechende Antwortformate definierst.
Hinweis: Wenn du schon dabei bist, kläre bitte auch gleich, um welches Messniveau (Skalenniveau) es bei jeder Messung deiner Konstrukte geht.
Und weil wir das ganze natürlich von Anfang an sauber machen wollen, wäre hier auch ein Codebook anzulegen. Eine einfache Tabelle reicht.
Output Schritt 3:
- Je Konstrukt:
- Items, die das Konstrukt messen (inkl. Antwortformat)
- Je Item die Klärung des Skalenniveaus
- Codebook (über alle Konstrukte/Items)
Beispiel
- Schlafdauer
- Schlaftagebuch (qualitativ); wird später kodiert -> nominal
- Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) -> oridnal / quasi-metrisch
- Objektive Aufzeichnung mittels Oura Ring o.ä. _> metrisch
- Konzentrationsfähigkeit
- Selbsteinschätzung in Tagebuch (qualitative) -> nominal
- Skala nach Schwenkmezger & Schmidt-Atzert (1996) (z.B. Ich lasse mich bei der Arbeit leicht ablenken.)
- Codebook (Beschreibung):
- Stelle alle gemessenen Items dar inkl. technischen Namen und einer Kodierung der Antworten (z.B. 5-stufige Likert-Skala (1 = trifft gar nicht zu – 5 = trifft völlig zu))
Schritt 4: Sampling
Erstelle einen fiktiven Sampling-Plan für deine (nicht durchzuführende) Datensammlung. Definiere die Population, die Stichprobe und natürlich das Verfahren, das sich anbieten würde, wie du von der Population zu der Stichprobe gelangst (Stichprobeverfahren).#
Output Schritt 4:
- Beschreibung Population
- Beschreibung Stichprobeverfahren
- Beschreibung Stichprobe
Beispiel
- Population
- Personen, die im Jahr 2025 an einer Universität/Privatuniversität in Österreich studieren und die zwischen 18 und 25 Jahren alt sind.
- Stichprobeverfahren
- Klumpenstichprobe:
- Zufällige Auswahl von 20 Vollzeit Bachelor-Studiengängen innerhalb von Österreich.
- Kontaktaufnahme mit allen Studierenden der Population innerhalb dieser Studiengänge.
- Klumpenstichprobe:
- Stichprobe (Beschreibung)
- Beschreibe die fiktive Stichprobe anhand von demografischen Merkmalen. Dazu ist es mitunder hilfreich, den nächsten Schritt zuerst zu machen.
Schritt 5: Datenset generieren
Erstelle ein kurzes Beispieldatenset, dass konsistent mit Schritt 3 und Schritt 4 ist. Wie genau du vorgehst bleibt offen; jedenfalls soll am Schluß eine Tabelle mit 5-10 Fällen vorhanden sein.
Output Schritt 5:
- Datentabelle mit mindestens 5 Fällen.
Schritt 6: Reporting / Reflexion
Geh die vergangenen Schritte 1-5 nochmal gedanklich durch und mache Notizen, was schwer war und was leicht. Wenn du magst, kannst du auch versuchen, den Prozess schriftlich darzustellen (was spätestens beim wissenschaftlichen Arbeiten dann immer gefragt ist).
Output Schritt 6:
- Zusammenfassende Reflexion
- Evt. schriftliches Reporting über den Gesamtprozess