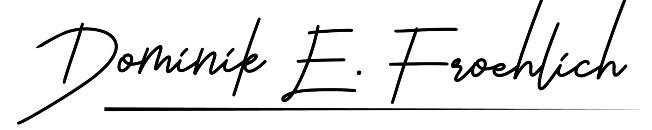Du musst eine Forschungslücke finden, hast aber keine Ahnung, wo du bei all den Papers überhaupt anfangen sollst?
Zwischen tausenden Studien, widersprüchlichen Theorien und vagen Ideen kann die Suche nach einer echten Forschungslücke ganz schön überfordern.
In diesem Beitrag erfährst du, wie du Schritt für Schritt eine relevante und machbare Lücke in deinem Forschungsthema findest, ohne dabei im Literaturdschungel zu versinken.
Was ist eine Forschungslücke?
Eine Forschungslücke ist wie ein blinder Fleck.
Also eine Frage, die bisher noch nicht (ausreichend) beantwortet wurde oder ein Kontext, der in der bisherigen Forschung kaum vorkommt.
Wichtig: Eine Lücke ist nicht einfach ein interessantes Thema. Es ist der konkrete Punkt in deinem Thema, an dem du mit deiner eigenen Arbeit sinnvoll anknüpfen kannst – und damit echten Mehrwert für die Forschung leistest.
Warum „einfach drauflosschreiben“ nicht reicht
Wer mit der Abschlussarbeit beginnt, macht oft einen typischen Fehler: Man sucht sich ein Thema, das irgendwie interessant klingt, fängt mit der Literaturrecherche an – und verliert sich dann im PDF-Chaos.
Plötzlich sind 35 Tabs offen, aber du hast keinen Plan, worauf du eigentlich hinauswillst.
Der Grund: Dir fehlt eine klare Forschungslücke. Und ohne Lücke kein roter Faden – und damit auch keine überzeugende wissenschaftliche Argumentation.

In 5 Schritten zur passenden Forschungslücke
Diese kurze Übersicht zeigt dir die wichtigsten Stationen auf dem Weg zu deiner passenden Forschungslücke. Danach erfährst du, wie du jeden Schritt im Detail umsetzt.
- Wähle einen groben Themenbereich, der dich interessiert
- Starte eine erste Literaturrecherche
- Sammle 5-10 relevante Studien
- Finde den FRIN – Lies gezielt die Schlussabschnitte, um Hinweise auf offene Fragen zu finden
- Prüfe, ob diese Lücke schon bearbeitet wurde – wenn nicht, hast du dein Themenbereich gefunden
1. Starte mit einem groben Themenbereich
Bevor du dich verlierst: Fange erstmal breit an.
Zum Beispiel „Jobzufriedenheit“ statt „Jobzufriedenheit bei Berufseinsteigerinnen im öffentlichen Dienst“.
Dein Ziel ist, zunächst ein grobes Spielfeld abzustecken – nicht sofort die perfekte Forschungslücke zu finden.
Achtung: Prüfe vorher, ob dein Themenbereich überhaupt zu deinem Studiengang und den Vorgaben deiner Uni passt.
2. Mach eine erste Literatursuche
Hier geht es vorallem um eine erste, gezielte Recherche. Dafür eignet sich Google Scholar am besten.
Gib Schlagwörter wie „Jobzufriedenheit“, „Arbeitsmotivation“ oder „Work-Life-Balance im Homeoffice“ ein. Probiere verschiedene Begriffe und Variationen aus, um deinen Suchradius zu erweitern.
Wichtig: Nutze das Filtermenü (links oben), um deine Ergebnisse auf aktuelle Studien der letzten zwei Jahre zu beschränken – so bleibst du am Puls der Forschung.
3. Suche dir interessante Studien raus
Lies zunächst nur Titel und Abstracts der gefundenen Arbeiten. Frag dich bei jedem Paper: Passt das zu meinem Thema? Interessiert mich das?
Speichere dir die Studien, die relevant wirken, ab – aber keine Sorge, du musst sie noch nicht komplett lesen.
Falls du keinen Zugang zu den Volltexten hast, suche nach Open Access-Versionen über Google oder nutze Plattformen wie DOAJ oder Elsevier Open Access.
4. Finde den FRIN
FRIN steht für Further Research Is Needed.
Dieser Satz (oder Varianten wie „future research should…“, „limitations include…“, etc.) steht fast immer am Ende einer Studie. Genau hier geben Forscher Hinweise, wo noch Fragen offen sind.
Scanne gezielt die letzten Abschnitte jeder Studie nach solchen Formulierungen und schreib dir die Hinweise auf. Das ist Gold für deine Themenwahl.

5. Prüfe, ob die Forschungslücke schon besetzt ist
Bevor du zu früh jubelst: Schau nochmal bei Google Scholar nach, ob in den letzten 12 Monaten schon jemand genau diese Lücke untersucht hat.
Was tun, wenn ich keine Forschungslücke finde?
Du hast gesucht, gelesen, gescrollt – und trotzdem keine klare Forschungslücke entdeckt? Keine Sorge, das passiert vielen.
Statt aufzugeben, suche gezielt nach Lücken im Kontext:
Solche indirekten Lücken sind genauso valide und oft sogar besonders spannend. Bleib also offen, hinterfrag Studien kritisch und gib dir Zeit.
Fazit: Mit System zur Forschungslücke
Eine Forschungslücke zu finden ist keine Zauberei, aber sie fällt dir auch nicht einfach in den Schoß. Es braucht einen klaren Plan, etwas Geduld und den Mut, groß zu starten und gezielt einzugrenzen.
Wenn du strukturiert vorgehst, relevante Literatur kritisch liest und den Kontext im Blick behältst, wirst du nicht nur ein spannendes Thema finden – sondern auch den roten Faden, der deine Abschlussarbeit trägt.
Viel Erfolg! 😊