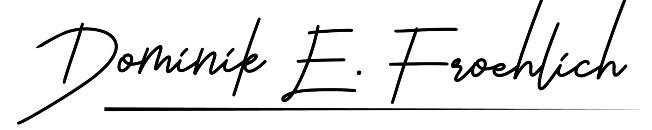Eine präzise und gut formulierte Forschungsfrage ist der Herzschlag deiner wissenschaftlichen Arbeit.
Wenn Du sie einmal klar hast, wird alles andere einfacher: die Literaturrecherche, die Methode, die Analyse und sogar das Schreiben.
In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie Du Schritt für Schritt eine starke Forschungsfrage finden kannst – ganz ohne Umwege und Frust.
Warum eine gute Forschungsfrage entscheidend ist
Die Forschungsfrage gibt Deiner Arbeit Richtung und Struktur. Ohne sie ist Deine Arbeit wie ein Kompass ohne Nadel – es geht irgendwie weiter, aber keiner weiß so recht wohin.
Eine gute Forschungsfrage sorgt für Klarheit: Du weißt, wonach Du suchst, was dazugehört – und was nicht. Das gibt Dir Sicherheit und reduziert Überforderung.
Also: Gib dein bestes beim Forschungsfrage finden und du hast weit weniger Sorgen im Rest des Prozesses!

Einstieg in die Forschung
Zentrale Konzepte erkennen
Bevor du deine Forschungsfrage präzise formulierst, lohnt sich ein genauer Blick auf deine erste Idee. Denn in jeder Idee – so vage sie zunächst auch wirken mag – stecken bereits wichtige Hinweise auf zentrale Begriffe und Themen.
Versuche herauszufinden, welche Begriffe in deiner Idee auftauchen und welche davon das inhaltliche Zentrum bilden.
Beispiel:
„Die Wahrnehmung von Marken durch visuelles Design“
Wenn du diese Aussage genau betrachtest, wirst du zwei zentrale Konzepte entdecken:
→ „visuelles Design“ und „Markenwahrnehmung“.
Diese beiden Begriffe bilden den inhaltlichen Kern deiner späteren Forschungsfrage – sie bestimmen, worum es in deiner Arbeit im Wesentlichen gehen wird.
Übung: Hauptbegriffe identifizieren
Schreibe deine Idee oder deine erste vorläufige Frage auf. Dann notiere alle darin enthaltenen Begriffe. Im nächsten Schritt markierst du diejenigen, die wirklich zentral sind – also die Konzepte, um die sich alles drehen soll.
Diese Übung hilft dir nicht nur, deine Gedanken zu ordnen, sondern auch, eine fundierte und zielgerichtete Forschungsfrage zu entwickeln.
Von der Idee zur konkreten Fragestellung
Generalisieren und Konkretisieren
Die beste Strategie, um deine Fragestellung zu verfeinern: Denk modular. Du kannst einzelne Teile Deiner Frage größer oder kleiner machen, je nachdem, was machbar und sinnvoll ist.
Beispiele für Generalisierung
- „Farbgestaltung“ → „visuelles Design“ → „Design“
- „Nachhaltigkeitsimage“ → „Markenwahrnehmung“
Beispiele für Konkretisierung
- „Design“ → „visuelles Design“ → „Farbwahl im Logo“
- „Markenwahrnehmung“ → „Wahrnehmung von Authentizität einer Marke“
Übung: Satzglieder untersuchen
Schau dir deine Forschungsfrage genau an und identifiziere die einzelnen Elemente, die darin stecken. Oft lässt sie sich in kleinere Einheiten aufteilen, die dir helfen, Klarheit über den Aufbau und die Zielrichtung deiner Untersuchung zu gewinnen.
Beispielsweise könntest du folgende Bestandteile unterscheiden:
- Was? – Welcher Zusammenhang oder Einfluss soll untersucht werden?
- Wie? – Welche Perspektive oder welches Konzept steht im Fokus?
- Was genau? – Welcher Aspekt interessiert dich besonders?
- Wer? – Auf welche Zielgruppe bezieht sich die Frage?
Diese Zerlegung hilft dir dabei, die Frage strukturiert zu analysieren – und sie bei Bedarf zu schärfen oder präziser zu formulieren.
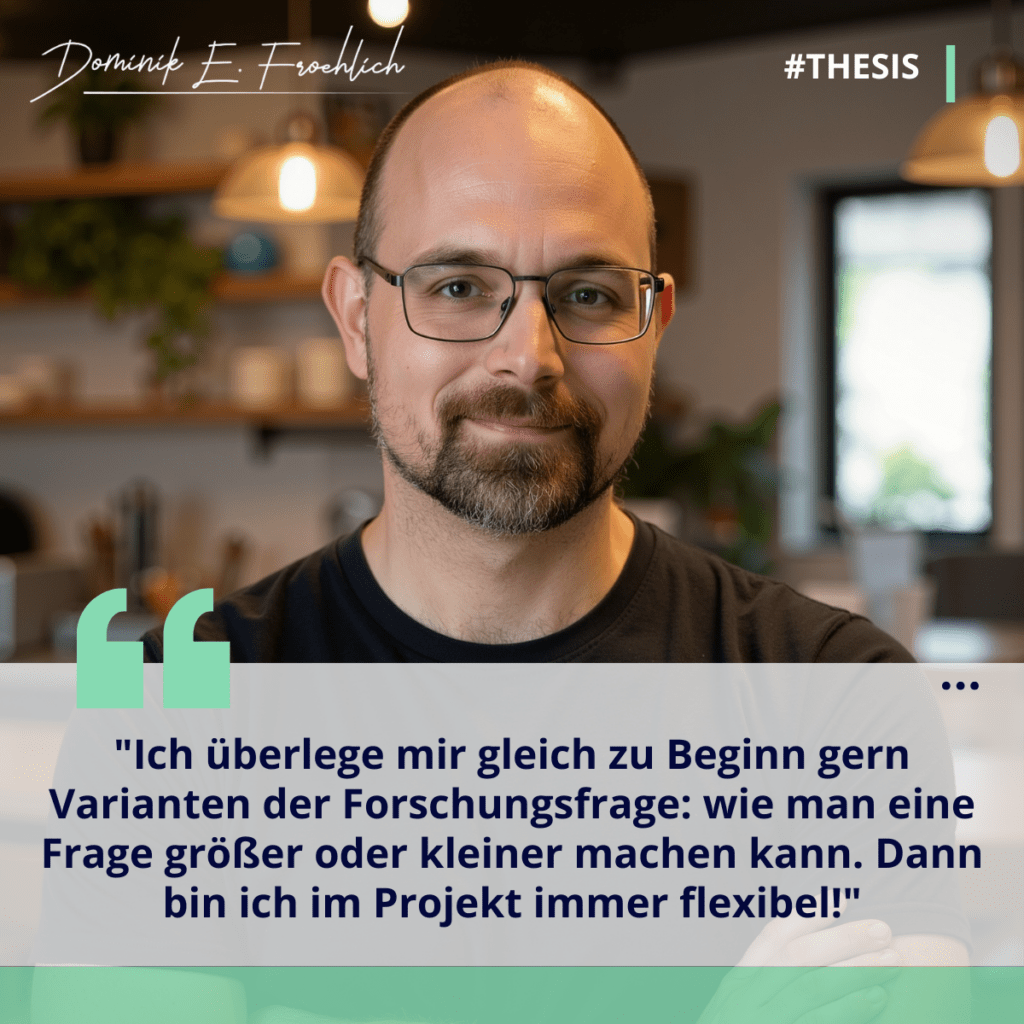
Den Fokus schärfen
Wenn deine Forschungsfrage noch unscharf oder zu komplex wirkt, kann es hilfreich sein, bewusst an bestimmten Stellschrauben zu drehen.
Dadurch gewinnst du mehr Klarheit und machst deine Frage präziser und besser untersuchbar.
Zielgruppe eingrenzen
Eine klare Eingrenzung der Zielgruppe bringt deinen Fokus auf den Punkt. Überlege dir, für wen deine Frage relevant ist und welche Gruppe du konkret untersuchen möchtest.
- Studierende
- Autokäufer:innen
- Generation Z
- Berufstätige im Marketing
Perspektivwechsel
Indem du die Perspektive bewusst wechselst, kannst du neue Facetten deines Themas entdecken und die Forschungsfrage besser eingrenzen.
- „Wie nehmen Käufer:innen das Design wahr?“
- „Wie sehen Designer:innen die Wirkung des Designs auf Markenwahrnehmung?“
- „Wie beeinflusst das visuelle Design die Markenwahrnehmung aus Sicht der Verkäufer:innen?“
Weitere Variationen
Neben Zielgruppe und Perspektive gibt es weitere Stellschrauben, die du bedenken solltest, um deine Frage fokussiert und realistisch zu gestalten:
Region bestimmen
Falls sinnvoll, kannst du den geografischen Rahmen eingrenzen, z. B. auf Österreich, den deutschsprachigen Raum oder eine einzelne Stadt wie Wien.
Funktionsweise durchdenken
Wie möchtest du deine Fragestellung messen oder untersuchen? Zum Beispiel mit Interviews, Umfragen oder Experimenten? Je nach Methode solltest du die Frage größer oder kleiner anlegen.

Die Forschungsfrage als flexibles Konstrukt
Warum ein Plan B immer sinnvoll ist
Du merkst während deiner Arbeit, dass etwas nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast?
Kein Problem! Forschung ist kein starrer Prozess – ganz im Gegenteil. Deine Forschungsfrage darf und soll sich weiterentwickeln, solange du den roten Faden im Blick behältst.
Beispiel
Du merkst, dass „visuelles Design“ zu eng gefasst ist, weil dir die Befragten ständig etwas über das Gesamtdesign erzählen.
→ In dem Fall ist es absolut legitim (und klug!), deine Frage entsprechend anzupassen.
Kleine Anpassungen – große Wirkung
Schon kleine Drehungen an deiner Forschungsfrage können viel verändern und dich wieder auf Kurs bringen. Um deine Fragestellung während des Prozesses nochmal zu überarbeiten, orientiere dich an den Strategien aus dem Beitrag. Das heißt:
- Konkretisiere deine Konzepte → So kannst du präziser messen und gezielter analysieren.
- Grenze deine Zielgruppe ein → So wird dein Vorhaben realistischer ohne an Relevanz zu verlieren.
- Spiel mit verschiedenen Perspektiven → So schärfst deinen roten Faden und hilfst Leser:innen beim Mitdenken.
Solltest du weitere Stellschrauben benötigen, versuch es mit diesen:
- Teilaspekt herausgreifen → Statt das gesamte Themenfeld abzudecken, konzentriere dich auf einen bestimmtem Aspekt. Dadurch kannst du tiefergehende Erkenntnisse zu einem klar abgegrenzten Bereich gewinnen.
- Methodik anpassen→ Statt nur Umfragen zu verwenden, kombiniere qualitative Interviews mit quantitativen Daten. So erhältst du differenziertere und valide Ergebnisse, die verschiedene Perspektiven abbilden.
Fazit
Eine gute Forschungsfrage muss nicht von Anfang an perfekt sein. Aber sie sollte klar, machbar und sinnvoll eingegrenzt sein.
Wenn du die hier vorgestellten Schritte durchgehst, hast du nicht nur eine gute Fragestellung, sondern auch eine solide Grundlage für den gesamten Forschungsprozess.
Du bist nicht allein mit deinen Fragen. Tausche dich mit anderen aus, frag deine:n Betreuer:in – und trau dich, die Frage im Laufe des Prozesses zu verfeinern.
Viel Erfolg! 😊