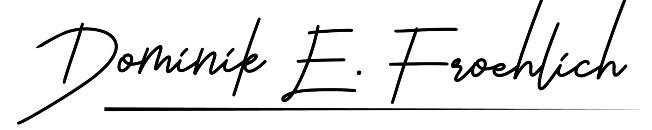So findest du den passenden Forschungsansatz
Wenn du gerade dabei bist, dein Forschungsdesign zu wählen, kann es gut sein, dass du schon einmal auf die Begriffe explorative Forschung und konfirmatorische Forschung gestoßen bist.
Sicherlich hast du dich schonmal gefragt, was diese Begriffe genau bedeuten? Und vor allem: Welcher Ansatz passt besser zu deinem Thema?
In diesem Beitrag erfährst du alles, was du wissen musst, um die richtige Wahl für deinen Forschungsansatz zu finden – egal ob explorativ oder konfirmatorisch.
Warum ist die Wahl des Forschungsdesigns so wichtig?
Dein Forschungsdesign bestimmt, wie du den Aufbau deiner Abschlussarbeit gestaltest, welche Methoden du nutzt und wie du deine Ergebnisse interpretierst.
Wenn du den falschen Ansatz wählst, kannst du schnell frustriert oder überfordert sein. Aber keine Sorgen! Wir führen dich Schritt für Schritt durch beide Ansätze – damit du die richtige Wahl triffst.
Explorative Forschung
Entdecken, Erkunden, Verstehen
Explorative Forschung klingt vielleicht kompliziert, aber es geht im Grunde darum, etwas Neues zu entdecken.
Sie wird eingesetzt, wenn zu einem Thema noch wenig bekannt ist und zunächst ein grundlegendes Verständnis entwickelt werden soll.
Explorative Forschung hilft dir, Grundlagenwissen zu schaffen. Du beschreibst, was du siehst, und versuchst, erste Zusammenhänge zu erkennen.
„Ich habe relativ wenig Hintergedanken und Hintergrundwissen, wie etwas funktioniert, sondern ich muss das erst erarbeiten. Das kann bedeuten, ich sehe irgendein Phänomen, das noch nicht einmal einen Namen hat. Ich versuche, es zu beschreiben, und probiere, mit Menschen darüber zu reden, was genau das jetzt ist.“
– Dominik E. Froehlich
Wann solltest du explorative Forschung nutzen?
Dieser Forschungsansatz ist ideal, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, zu dem es noch nicht viel Forschung gibt.

Explorative Forschungsmethoden
Einigen Methoden eignen sich besser für explorative Forschungsmethoden als andere. Diese passen zu deinem explorativen Forschungsdesign:
Vorteile und Nachteile explorativer Forschung
Beispiele für explorative Forschung
- Welche neuen Arbeitsweisen entstehen durch Remote Work in Start-ups?
- Wie nehmen Mitarbeiter:innen die neue Führungskultur in modernen Unternehmen wahr?
- Welche Erfahrungen machen Student:innen mit KI-gestützten Lernplattformen im Studienalltag?
- Wie verändert sich das Zugehörigkeitsgefühl von Mitarbeiter:innen im Homeoffice?
Konfirmatorische Forschung
Prüfen, Bestätigen, Beweisen
Im Gegensatz zur explorativen Forschung nutzt du bei konfirmatorischer Forschung bereits vorhandenes Wissen.
Du hast klare Hypothesen, die du testen möchtest.
„Hier probierst du etwas zu bestätigen. Du entwickelst ein statistisches Modell, sammelst empirische Daten und schaust, ob dein theoretisches Modell zu den Daten passt.“
– Dominik E. Froehlich

Wann solltest du konfirmatorische Forschung nutzen?
Dieser Forschungsansatz ist eignet sich, wenn bereits fundierte Forschungen zu deinem Thema existieren.
Konfirmatorische Forschungsmethoden
Vor- und Nachteile konfirmatorischer Forschung
Beispiele für konfirmatorische Forschung
- Führt flexible Arbeitszeit zu höherer Arbeitszufriedenheit bei Mitarbeitenden der Generation Z?
- Verbessert regelmäßiges Feedback die Leistung in Vertriebsteams?
- Erhöht ein hybrides Arbeitsmodell die Mitarbeiterbindung in mittelständischen Unternehmen?
- Reduziert Achtsamkeitstraining nachweislich das Stressempfinden bei Führungskräften?
Fazit: Das passende Forschungsdesign wählen
Die Wahl zwischen explorativer und konfirmatorischer Forschung ist entscheidend für deine Abschlussarbeit.
Prüfe sorgfältig den Wissensstand deines Themas, deine Ziele und die Machbarkeit. So findest du das passende Forschungsdesign und vermeidest Überforderung.
Und das Wichtigste: Bleib entspannt – du hast alles, was du brauchst, um die richtige Entscheidung zu treffen!
Viel Erfolg! 😊