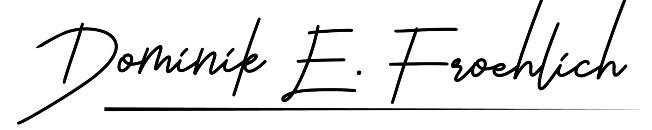Wenn du gerade dabei bist, dein Forschungsdesign zu wählen, kann es gut sein, dass du schon einmal auf die Begriffe explorative Forschung und konfirmatorische Forschung gestoßen bist. Vielleicht hast du dich gefragt: Was bedeuten diese Begriffe eigentlich genau? Und vor allem: Welcher Ansatz passt besser zu deinem Thema? Keine Sorge – hier bekommst du eine klare und verständliche Anleitung, damit du genau weißt, welchen Weg du für deine Bachelorarbeit einschlagen solltest.
Warum ist die Wahl des Forschungsdesigns so wichtig?
Dein Forschungsdesign bestimmt, wie du deine Bachelorarbeit aufbaust, welche Methoden du nutzt und wie du deine Ergebnisse interpretierst. Wenn du hier den falschen Ansatz wählst, kannst du schnell frustriert oder überfordert sein. Aber keine Panik! Ich führe dich Schritt für Schritt durch beide Ansätze, damit du die richtige Wahl treffen kannst.
Explorative Forschung: Entdecken, Erkunden, Verstehen
Explorative Forschung klingt vielleicht kompliziert, aber es geht im Grunde darum, etwas Neues zu entdecken. Dieser Ansatz ist ideal, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, zu dem es noch nicht viel Forschung gibt.
Wann solltest du explorative Forschung nutzen?
- Dein Thema ist neu oder wenig erforscht.
- Du möchtest ein Phänomen besser verstehen oder beschreiben.
- Es gibt keine etablierten Messinstrumente oder klare Hypothesen zu deinem Thema.
Explorative Forschung hilft dir, Grundlagenwissen zu schaffen. Du beschreibst, was du siehst, und versuchst, erste Zusammenhänge zu erkennen.
„Hier habe ich relativ wenig Hintergedanken und auch relativ wenig Hintergrundwissen, wie etwas funktioniert, sondern ich muss das erst erarbeiten. Das kann bedeuten, ich sehe irgendein Phänomen, das Phänomen hat noch nicht einmal einen Namen. Ich versuche, es zu beschreiben, und probiere, mit Leuten darüber zu reden, was genau das jetzt ist.“
Dominik E. Froehlich
Beispiele für explorative Forschung
- Welche neuen Arbeitsweisen entstehen durch Remote Work in Start-ups?
- Wie nehmen Mitarbeiter:innen die neue Führungskultur in modernen Unternehmen wahr?
Geeignete Methoden für explorative Forschung
- Interviews
- Gruppendiskussionen
- Beobachtungen
Vor- und Nachteile explorativer Forschung
Vorteile:
- Flexibilität in der Vorgehensweise
- Ideal, um neue Themen zu erschließen
- Weniger Druck, Hypothesen bestätigen zu müssen
Nachteile:
- Ergebnisse sind oft allgemein und nicht verallgemeinerbar
- Schwieriger, klare Aussagen zu treffen
Konfirmatorische Forschung: Prüfen, Bestätigen, Beweisen
Im Gegensatz zur explorativen Forschung nutzt du bei konfirmatorischer Forschung bereits vorhandenes Wissen. Du hast klare Hypothesen, die du testen möchtest.
Wann solltest du konfirmatorische Forschung nutzen?
- Dein Thema ist bereits gut erforscht.
- Du kannst klare Hypothesen aufstellen.
- Du möchtest prüfen, ob bestimmte Annahmen stimmen.
„Hier probierst du etwas zu bestätigen. Du entwickelst ein statistisches Modell, sammelst empirische Daten und schaust, ob dein theoretisches Modell zu den Daten passt.“
Dominik E. Froehlich
Beispiele für konfirmatorische Forschung
- Führt flexible Arbeitszeit zu höherer Arbeitszufriedenheit bei Mitarbeitenden der Generation Z?
- Verbessert regelmäßiges Feedback die Leistung in Vertriebsteams?
Geeignete Methoden für konfirmatorische Forschung
- Umfragen und standardisierte Fragebögen
- Experimente
- Statistische Datenanalyse
Vor- und Nachteile konfirmatorischer Forschung
Vorteile:
- Klare Ergebnisse durch statistische Verfahren
- Hohe Aussagekraft und Generalisierbarkeit der Ergebnisse
- Gut strukturiertes Vorgehen
Nachteile:
- Wenig Raum für unerwartete Ergebnisse
- Setzt vorhandenes Wissen voraus, nicht ideal für neue Themen
Schritt für Schritt: So wählst du dein Forschungsdesign
Schritt 1: Status deines Themas prüfen
Überlege, wie viel bereits über dein Thema bekannt ist. Nutze hierfür Literaturdatenbanken oder Google Scholar:
- Gibt es bereits viele Studien?
- Ist dein Thema eher neu?
Schritt 2: Ziele deiner Forschung definieren
Frage dich:
- Möchtest du etwas Neues entdecken (explorativ)?
- Oder willst du vorhandene Hypothesen überprüfen (konfirmatorisch)?
Schritt 3: Überprüfe die Machbarkeit
Machbarkeit heißt:
- Sind die benötigten Daten einfach zu erheben?
- Hast du die Ressourcen und Kenntnisse für dein gewähltes Design?
Schritt 4: Methode passend zum Design wählen
Je nachdem, ob du explorativ oder konfirmatorisch arbeitest, entscheidest du dich für qualitative (z.B. Interviews) oder quantitative Methoden (z.B. Umfragen).
Schritt 5: Besprich dein Vorgehen
Besprich dein Forschungsdesign unbedingt mit deinem Betreuer oder deiner Betreuerin. So stellst du sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist.
Häufige Fehler und wie du sie vermeidest
Fehler 1: Zu früh ein konfirmatorisches Design wählen
Manchmal versuchen Studierende, Hypothesen zu testen, bevor überhaupt genug Wissen vorhanden ist. Starte in diesem Fall lieber explorativ.
Fehler 2: Explorativ bleiben, obwohl das Wissen ausreichend ist
Wenn du bereits klare Erwartungen hast, aber weiter explorativ bleibst, verschwendest du eventuell Potenzial. Wechsle dann lieber zur konfirmatorischen Forschung.
Fehler 3: Zu komplizierte Methoden wählen
Wähle Methoden, die du gut beherrschst oder leicht lernen kannst. Ein einfaches, klares Design ist oft besser als ein kompliziertes, das dich überfordert.
Fazit: Das passende Forschungsdesign wählen
Die Wahl zwischen explorativer und konfirmatorischer Forschung ist entscheidend für deine Bachelorarbeit. Prüfe sorgfältig den Wissensstand deines Themas, deine Ziele und die Machbarkeit. So findest du das passende Forschungsdesign und vermeidest Überforderung.
Bleib entspannt – du hast alles, was du brauchst, um die richtige Entscheidung zu treffen!