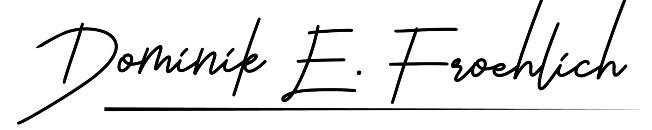Du sitzt vor einem leeren Word-Dokument. Dein Thema steht, die Gliederung ist grob da – aber der erste Satz will einfach nicht kommen? Willkommen im Club! Die Einleitung zu schreiben ist oft eine der größten Hürden bei der Abschlussarbeit. Und gleichzeitig ist sie das wichtigste Tor zu Deiner wissenschaftlichen Argumentation. Denn: Sie entscheidet, ob Deine Leser:innen (und Betreuer:innen!) verstehen, worum es eigentlich geht, warum das Thema relevant ist – und was Du beitragen willst.
Aber keine Sorge: Du musst das Rad nicht neu erfinden. In diesem Blogartikel bekommst Du eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du die Einleitung deiner Abschlussarbeit schreiben kannst – strukturiert, logisch und überzeugend.
„Ich halte mich da immer an eine Viersatz- oder Vier-Absatz-Struktur. Wenn man der folgt, hat man das perfekte Argument für die Forschungsfrage.“
Genau diese Struktur lernst Du hier kennen. Und wir zeigen Dir, wie Du typische Fehler vermeidest – wie zu allgemeine Fragen, methodische Brüche oder überambitionierte Zielsetzungen. Am Ende weißt Du, wie Du klar, präzise und mit rotem Faden in Deine Arbeit startest. Bereit? Los geht’s!
WARUM DIE EINLEITUNG SO WICHTIG IST: DER PERFEKTE START FÜR DEINE ARBEIT
Wenn Du eine wissenschaftliche Arbeit schreibst, dann weißt Du: Der Anfang ist oft das Schwierigste. Besonders bei der Einleitung ist das Gefühl „Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll!“ ziemlich verbreitet. Dabei ist genau dieser Teil entscheidend: Die Einleitung ist das Fundament deiner Argumentation – und sie entscheidet oft, ob deine Leser:innen (und Betreuer:innen!) direkt überzeugt sind oder sich erstmal orientieren müssen.
In diesem Blogartikel zeige ich Dir Schritt für Schritt, wie Du die perfekte Einleitung deiner Abschlussarbeit schreiben kannst – klar, logisch aufgebaut und mit einem guten Argument für deine Forschungsfrage. Und das Beste: Du bekommst ein konkretes Strukturmodell, das Du sofort auf dein Thema anwenden kannst.
Was eine gute Einleitung leisten muss
Eine gute Einleitung hat ein ganz klares Ziel: Sie soll ein überzeugendes Argument dafür liefern, warum deine Forschungsfrage wichtig und relevant ist.
Dabei erfüllt sie mehrere Funktionen:
- Sie gibt Orientierung: Was ist das Thema und warum ist es bedeutend?
- Sie zeigt den aktuellen Stand der Forschung: Was weiß man schon?
- Sie benennt die Forschungslücke (Gap): Was fehlt bisher?
- Sie stellt die Forschungsfrage und das Vorgehen vor: Was machst Du und wie?
„Ich halte mich da immer an eine Viersatz- oder Vier-Absatz-Struktur. Wenn man die folgt, hat man das perfekte Argument für die Forschungsfrage bzw. für die ganze Arbeit.“
Diese Struktur schauen wir uns gleich noch genauer an.
Der erste Eindruck zählt: Die Einleitung als Visitenkarte deiner Arbeit
Die Einleitung ist das Erste, was Korrektor:innen lesen – sie prägt den Eindruck, den Deine Arbeit macht. Wenn sie klar und logisch aufgebaut ist, wirkt Deine gesamte Arbeit gleich viel strukturierter. Und: Eine starke Einleitung gibt auch Dir selbst Sicherheit, weil Du deine Argumentationslinie schon sauber gelegt hast.
„Wenn man das so macht, das ist der prototypische Aufbau einer Einleitung: Ich habe einfach ein sehr, sehr starkes Argument, warum das jetzt irgendwie wichtig ist, warum man das so angeht.“
Die häufigsten Probleme beim Schreiben der Einleitung
Du bist nicht allein, wenn Dir die Einleitung schwerfällt. Hier sind die typischen Stolpersteine:
Zu allgemein oder zu speziell?
Viele starten zu weit oben („Klimawandel ist ein großes Problem“) oder zu tief drin („In der Bezirksstraße XY wurde 2022…“). Der richtige Einstieg liegt dazwischen: verständlich, aber mit Fokus.
Zu viel Vorwissen vorausgesetzt
Ein häufiger Fehler ist es, gleich mit Fachbegriffen loszulegen, ohne Kontext. Leser:innen brauchen eine kurze Einführung ins Thema, bevor Du in die Tiefe gehst.
Relevanz bleibt unklar
Warum genau ist Dein Thema wichtig? Wenn das nicht rüberkommt, wirkt die ganze Arbeit blass – selbst wenn sie inhaltlich stark ist.
Forschungslücke nicht sauber dargestellt
Ohne eine klar benannte Lücke („Was weiß man noch nicht?“) fehlt Deiner Arbeit die Begründung. Die Einleitung ist der Ort, um diesen Gap deutlich zu machen.
Der 4-Absatz-Bauplan für die perfekte Einleitung
Jetzt kommt das Herzstück: Eine klare Struktur, mit der Du deine Einleitung sicher schreiben kannst. Diese 4 Absätze kannst Du (fast) immer verwenden:
Absatz 1: Relevanz des Themas aufzeigen
Starte mit einem allgemeinen Einstieg. Zeige, warum das Thema gesellschaftlich, wirtschaftlich oder wissenschaftlich relevant ist.
„Das stellt sich vor den ersten Absatz von einer Arbeit, wo man darum schreibt, irgendwelche Nationalstatistiken, wie viele dieses Problem haben oder so etwas. Also wirklich High Level, ja, relevant.“
Beispiel:
In den letzten Jahren ist die Anzahl an Fernbeziehungen durch digitale Kommunikationsmittel stark gestiegen. Laut einer Studie aus Indonesien sind mittlerweile über 20 % der jungen Paare in solchen Konstellationen.
Absatz 2: Was weiß man schon? – Stand der Forschung
Jetzt zeigst Du, was die Wissenschaft bisher zu deinem Thema herausgefunden hat. Kurz und prägnant – nur das Wichtigste.
„Wir starten da nicht ganz auf der grünen Wiese, irgendwas wird jetzt darüber schon gegeben, dann kann ich sagen, okay, wir wissen über long distance relationships folgendes.“
Beispiel:
Bisherige Studien zeigen, dass Fernbeziehungen sowohl positive als auch negative Effekte auf die Beziehungszufriedenheit haben können. Faktoren wie Vertrauen, Kommunikation und soziale Unterstützung wurden dabei besonders häufig untersucht.
Absatz 3: Was weiß man noch nicht? – Die Forschungslücke (Gap)
Hier kommt Dein wichtigster Punkt: Was fehlt in der Forschung? Was wurde noch nicht betrachtet oder nur unzureichend?
„Das wäre der Gap, das wäre die Forschungslücke: Was weiß ich noch nicht in diesem Forschungsgebiet.“
Beispiel:
Unklar ist bislang, wie genau sich Fernbeziehungen auf das psychische Wohlbefinden der einzelnen Personen in der Partnerschaft auswirken – insbesondere in Ländern mit eingeschränktem Zugang zu psychologischer Betreuung.
Absatz 4: Was wirst Du tun? – Ziel und Vorgehen deiner Arbeit
Zum Schluss erklärst Du, was genau Du in deiner Arbeit vorhast – deine Forschungsfrage und ggf. deine Methode.
„Und dann kommt in der letzte Absatz, wo ich beschreibe, okay, und wie stelle ich mir das jetzt vor, dass ich diese Forschungsfrage beantworte.“
Beispiel:
Die vorliegende Arbeit untersucht anhand qualitativer Interviews mit Betroffenen in Indonesien, wie sich Fernbeziehungen auf deren psychisches Wohlbefinden auswirken. Ziel ist es, zentrale Einflussfaktoren zu identifizieren und besser zu verstehen, welche Unterstützungsbedarfe bestehen.
Beispielhafte Anwendung: Long-Distance-Relationships in Indonesien
Das Beispiel mit den Long-Distance-Relationships zeigt gut, wie aus einem alltäglichen Thema ein wissenschaftlich relevantes Problem werden kann. Der Aufbau folgt genau den vier Absätzen:
- Fernbeziehungen nehmen zu → Relevanz
- Es gibt schon Studien zu Beziehungsqualität → Forschungsstand
- Psychologisches Wohlbefinden wurde noch nicht konkret untersucht → Forschungslücke
- Qualitative Interviews sollen genau das erheben → Forschungsziel
So entsteht ein klarer, logischer Argumentationsbogen – und die Einleitung fühlt sich plötzlich machbar an!
Unterschied: Einleitung in Hausarbeit vs. Bachelor-/Masterarbeit
Auch wenn das Grundprinzip gleich bleibt, gibt es Unterschiede:
Umfang und Tiefe
In Hausarbeiten reichen oft ½ bis 1 Seite Einleitung. Bei Bachelor- oder Masterarbeiten darf es mehr sein – meist ca. 1,5 bis 2,5 Seiten.
Rolle der Einleitung
In kürzeren Arbeiten dient die Einleitung eher der Orientierung. In Abschlussarbeiten ist sie der zentrale Ort, um Deine Forschungsfrage logisch zu begründen – sie ist ein inhaltlicher Kern, kein „Vorgeplänkel“!
Fazit zu Abschnitt 1:
Wenn Du die Einleitung deiner Abschlussarbeit schreiben willst, mach es Dir einfach – folge dem 4-Absatz-Bauplan, denk an die Relevanz und nimm deine Leser:innen mit. Im nächsten Abschnitt zeige ich Dir dann ganz konkret, wie Du jeden dieser Schritte umsetzt – inklusive Formulierungsbeispielen und einer Checkliste für den Feinschliff.
SCHRITT FÜR SCHRITT DEINE EINLEITUNG SCHREIBEN: EIN PRAXISLEITFADEN
Wenn Du bis hierher gelesen hast, hast Du jetzt ein gutes Verständnis dafür, warum die Einleitung deiner Abschlussarbeit so wichtig ist – und wie der klassische Aufbau funktioniert. Aber wie kommst Du nun konkret zu deiner Einleitung? Genau darum geht es jetzt. Schritt für Schritt leite ich Dich durch den Prozess – ganz klar, ganz machbar.
Los geht’s!
Schritt 1: Thema eingrenzen und kontextualisieren
Viele Studierende starten zu breit. Kein Wunder – schließlich interessiert man sich ja oft für große gesellschaftliche Fragen. Aber: Für eine wissenschaftliche Arbeit brauchst Du ein gut abgestecktes Feld.
Stell Dir folgende Fragen:
- Welcher Aspekt des Themas interessiert Dich am meisten?
- Gibt es aktuelle Zahlen, Trends oder Probleme dazu?
- Wer ist davon betroffen – und warum ist das wichtig?
Ein starker Einstieg nennt oft konkrete Zahlen oder Entwicklungen:
„Da kann man sagen, okay, da gibt es irgendwie einen Trend. Gleichzeitig ist es unsicher, wie sich das auswirkt.“
Wenn Du also zum Beispiel zum Thema Klimaneutralität in Städten schreiben willst, wäre ein möglicher Einstieg:
Immer mehr europäische Großstädte verfolgen das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden. In Wien etwa wurden bereits 2022 über 30 neue Maßnahmen beschlossen, um die CO₂-Emissionen im Stadtverkehr zu reduzieren.
So schaffst Du direkt Relevanz – und die Leser:innen sind mitten im Thema.
Schritt 2: Forschungslage zusammenfassen
Jetzt geht’s darum zu zeigen, was bisher über dein Thema bekannt ist. Du musst hier nicht eine komplette Literaturarbeit leisten, aber Du solltest ein paar zentrale Studien oder Erkenntnisse erwähnen.
Wichtig ist: Fokussiere Dich auf das, was direkt mit deiner Frage zu tun hat.
„Wir wissen über Long-Distance-Relationships folgendes …“
Oder im Klimabeispiel:
Frühere Studien zeigen, dass städtische Verkehrspolitik einen erheblichen Einfluss auf die CO₂-Bilanz hat. Maßnahmen wie autofreie Zonen, Tempolimits und der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel gelten als zentrale Hebel zur Emissionsreduktion.
Schritt 3: Die Forschungslücke (Gap) formulieren
Hier liegt oft der Knackpunkt: Du musst zeigen, was noch nicht ausreichend erforscht wurde. Das ist Deine Forschungslücke – auf Englisch „Gap“. Und das ist das stärkste Argument für Deine Arbeit.
„Das wäre der Gap. Das wäre die Forschungslücke – was weiß ich noch nicht in diesem Forschungsgebiet?“
Wenn Du z. B. viele Studien zur Verkehrspolitik findest, aber kaum welche, die konkret den Einfluss auf das subjektive Sicherheitsgefühl in bestimmten Stadtteilen untersuchen, könnte Dein Gap genau dort liegen.
Wichtig: Formuliere den Gap klar, aber nicht zu groß! Viele machen den Fehler, ganze Forschungsfelder aufreißen zu wollen. Versuch lieber, eine kleine, präzise Lücke zu benennen, die Du wirklich bearbeiten kannst.
Schritt 4: Forschungsfrage(n) ableiten
Jetzt wird’s konkret: Was genau willst Du wissen? Aus dem Gap ergibt sich (idealerweise automatisch) Deine Forschungsfrage.
„Im dritten Absatz kommt dann die Forschungsfrage, mit der wir diese Lücke zumindest verkleinern wollen.“
Eine gute Forschungsfrage ist:
- klar und verständlich,
- empirisch untersuchbar (qualitativ oder quantitativ),
- auf Dein Thema zugeschnitten.
Beispiel:
❌ Was macht Städte klimaneutral?
✅ Welche Maßnahmen der Wiener Verkehrspolitik tragen aus Expert:innensicht am stärksten zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei?
Der Unterschied? Die zweite Frage ist präzise, kontextbezogen und beantwortbar.
Schritt 5: Überblick über Vorgehen geben
Im letzten Absatz der Einleitung geht es darum, wie Du vorgehst. Du musst jetzt noch nicht jede Methode im Detail erklären – aber ein grober Fahrplan gehört dazu.
„Und wie stelle ich mir das jetzt vor, dass ich diese Forschungsfrage beantworte?“
Also zum Beispiel:
Zur Beantwortung dieser Frage werden Expert:inneninterviews mit Stadtplaner:innen und Mobilitätsverantwortlichen in Wien durchgeführt. Ziel ist es, die subjektiv wahrgenommenen Wirkmechanismen aktueller Maßnahmen herauszuarbeiten.
So wissen die Leser:innen, was sie erwartet – und warum Dein Vorgehen sinnvoll ist.
Bonus: Checkliste für deinen finalen Einleitungstext
Hier eine kleine Checkliste zum Abhaken – damit Du nichts vergisst:
✅ Beantwortet meine Einleitung folgende Fragen?
- Warum ist mein Thema relevant?
- Was ist bereits bekannt?
- Was fehlt bisher in der Forschung?
- Was will ich mit meiner Arbeit herausfinden?
- Wie gehe ich vor?
✅ Do’s & Don’ts beim Schreiben der Einleitung
Do:
- Nutze aktuelle Zahlen oder Studien als Einstieg
- Baue Deine Argumentation klar und logisch auf
- Halte Deine Forschungsfrage so konkret wie möglich
Don’t:
- Schreibe keine allgemeine „Laberei“ ohne Fokus
- Nutze keine Begriffe, die Du später nicht erklärst
- Vermeide doppelte Forschungsfragen („Was ist das Problem UND wie löst man es?“)
Beispielstruktur für alle, die gerne mit klaren Mustern arbeiten:
Hier kommt eine ganz einfache Struktur, die Du fast 1:1 übernehmen kannst:
- Absatz 1:
Thema kurz einführen + Relevanz begründen
Beispiel: Klimaneutralität ist ein zentrales Ziel vieler Städte, u. a. Wien… - Absatz 2:
Was weiß man schon in der Forschung?
Beispiel: Studien zeigen, dass Verkehrsmaßnahmen einen Einfluss auf CO₂ haben… - Absatz 3:
Was fehlt noch? (Gap)
Beispiel: Es gibt kaum qualitative Studien zu subjektiven Einschätzungen von Expert:innen… - Absatz 4:
Forschungsfrage + kurzes Vorgehen
Beispiel: Interviews mit Expert:innen sollen klären, welche Maßnahmen als besonders wirksam gelten.
„Wenn man das so macht, hat man ein sehr, sehr starkes Argument, warum das jetzt wichtig ist – ein komplett logischer Aufbau.“
Und das ist genau das, was Du willst, wenn Du die Einleitung deiner Abschlussarbeit schreiben möchtest – stark, klar und überzeugend.
Im nächsten Abschnitt schauen wir uns typische Fehler und Stolpersteine an – und wie Du sie vermeiden kannst.
TYPISCHE FALLSTRICKE VERMEIDEN UND DEINE EINLEITUNG VERBESSERN
Deine Einleitung steht – oder zumindest fast. Jetzt ist der perfekte Moment, nochmal kurz innezuhalten. Denn: Auch wenn Du den Aufbau verstanden hast und weißt, wie man Relevanz, Forschungslücke und Frage darstellt, gibt es ein paar typische Stolperfallen, die Du unbedingt vermeiden solltest. Lass uns gemeinsam durchgehen, worauf Du achten solltest, wenn Du die Einleitung deiner Abschlussarbeit schreiben willst – ohne dich zu verzetteln.
Problem 1: Deine Forschungsfrage ist zu allgemein
Viele starten mit zu großen Fragen. Verständlich – man will ja etwas Wichtiges erforschen! Aber: Wenn Deine Frage zu allgemein ist, kannst Du sie weder mit vertretbarem Aufwand beantworten noch präzise in Deiner Einleitung verankern.
„Warum ‚Was macht Städte klimaneutral?‘ keine gute Frage ist? Weil Klimaneutralität ein schönes, großes Konstrukt ist, wo viele Dinge reinspielen. Autos sind ein Teil davon – aber die Frage ist, ob du das wirklich so messen kannst.“
Besser: Brich große Begriffe herunter. Statt „Klimaneutralität“ vielleicht: Reduktion lokaler Schadstoffbelastung in Innenstädten durch Verkehrskonzepte.
Oder: Welche verkehrspolitischen Maßnahmen in Wien tragen laut Expert:innen besonders zur Reduktion von CO₂ bei?
Problem 2: Du willst zu viel auf einmal
Du willst den Klimawandel aufhalten, psychisches Wohlbefinden retten und gleichzeitig noch Handlungsempfehlungen für Unternehmen geben? I feel you. Aber: Eine Abschlussarbeit braucht Fokus.
„Das ist dann ein bisschen Over-Achieving. Dann wollen sie quasi die Welt erklären – das ist viel zu groß.“
Tipp: Frag dich: Was ist mein zentrales Konzept? Schreib’s dir auf ein Post-it und kleb es neben den Bildschirm. Wenn du merkst, dass du abschweifst – zurück zum Fokus.
Problem 3: Deine Frage ist rein deskriptiv
Zahlen zu nennen ist cool – aber reine Beschreibungen sind keine Forschungsfragen. „Wie viele Menschen besitzen ein Auto in Wien?“ ist zwar interessant, aber keine wissenschaftliche Analyse.
„Im seltensten Fall haben wir Forschungsfragen, wo die Antwort eine Zahl ist, sondern irgendwas, was ein bisschen mehr interpretiert werden muss.“
Tipp: Mach aus einer Zählfrage eine Analysefrage. Beispiel:
❌ Wie viele Autos gibt es in Wien?
✅ Inwiefern stellt die aktuelle PKW-Dichte ein Hindernis für städtische Klimaziele dar?
So entsteht eine echte Forschungsfrage – mit analytischem Mehrwert.
Problem 4: Du vergisst, die Relevanz deiner Frage zu begründen
Eine gute Einleitung beantwortet nicht nur Was will ich wissen?, sondern auch Warum interessiert das überhaupt jemanden?
„Wie rechtfertigt ihr das sozusagen?“
Typische Begründungsmuster für Relevanz:
- Gesellschaftlich: Welche Gruppen sind betroffen? Was ist das gesellschaftliche Problem?
- Wissenschaftlich: Warum ist es wichtig, diese Lücke in der Forschung zu schließen?
- Wirtschaftlich: Hat das Thema Einfluss auf Märkte, Unternehmen, Konsum?
Beispiel:
Employer Branding wird in der Praxis zunehmend als Erfolgsfaktor kommuniziert – doch ob es wirklich mit Unternehmensgewinn korreliert, bleibt empirisch unklar.
Problem 5: Keine Verbindung zwischen Frage und Methode
Ein klassischer Fehler: Du stellst eine tolle Frage – aber Deine Methode passt nicht dazu. Das ist ein No-Go.
„Wenn du qualitative Interviews machst, brauchst du keine Ja/Nein-Fragen.“
Beispiel:
❌ Wie viele Menschen nutzen Carsharing-Angebote in Berlin?
→ … aber dann führst Du Expert:inneninterviews durch? Das passt nicht.
✅ Welche Faktoren beeinflussen laut Mobilitätsverantwortlichen die Nutzung von Carsharing-Angeboten in Berlin?
→ Perfekte qualitative Forschungsfrage.
Tipp: Denk die Methode gleich mit. Stell Dir bei jeder Forschungsfrage die Frage: Wie würde ich das erheben?
Bonus: Fallbeispiel Klimaneutralität – Schritt für Schritt besser gemacht
Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an, das in der Lehrveranstaltung diskutiert wurde. Die ursprüngliche Frage war:
„Wie viele Menschen besitzen ein Auto in Wien – und was tut die Stadt für mehr Klimaneutralität?“
Diese Frage hat mehrere Probleme:
- Zwei Themen vermischt (Autobesitz + Stadtpolitik)
- Eine Teilfrage ist rein beschreibend
- Klimaneutralität ist ein zu breites Konzept
Mögliche Überarbeitung:
Welche Maßnahmen setzt die Stadt Wien aktuell im Bereich Verkehr um, um ihre Klimaziele zu erreichen – und wie bewerten Expert:innen deren Wirksamkeit?
Diese Version…
✅ ist klar fokussiert
✅ erlaubt qualitative Methodik (z. B. Expert:inneninterviews)
✅ stellt die Relevanz direkt her
„Das Ziel ist Klimaneutralität. Und man fragt die Experten: Was sind aus Ihrer Sicht die Top-3-Faktoren oder Maßnahmen, die man umsetzen müsste?“
Denk dran: Weniger ist mehr
Gerade in der Einleitung deiner Abschlussarbeit gilt: Ein klarer, logischer Aufbau schlägt epische Komplexität. Wenn Du:
- Dein Thema gut eingrenzt,
- die Forschungslücke logisch erklärst,
- eine konkrete Frage stellst,
- und diese mit der passenden Methode beantwortest,
dann bist Du schon viel weiter als viele andere.
„Ich habe einfach ein sehr, sehr starkes Argument, warum das jetzt irgendwie wichtig ist – ein komplett logischer Aufbau.“
Und genau das willst Du erreichen.
Was du jetzt tun kannst
✅ Nimm dir deine Einleitung vor und prüfe sie anhand dieser fünf Fallstricke.
✅ Nutze die Checkliste aus Teil 2, um sicherzustellen, dass du auf Kurs bist.
✅ Lies deine Forschungsfrage nochmal laut – klingt sie klar und beantwortbar?
Wenn Du magst, schick mir deine Einleitung oder die Forschungsfrage – ich geb Dir gern Feedback (oder such Dir eine:n Buddy in deinem Studiengang!).
Fazit:
Das Einleitung Abschlussarbeit schreiben muss kein Mysterium sein. Mit einem klaren Aufbau, einer guten Frage und dem Blick für typische Fehler kannst Du selbstbewusst loslegen – und eine Einleitung schreiben, die Lust aufs Weiterlesen macht.
FAZIT: Du kannst das – und jetzt weißt Du auch wie
Die Einleitung deiner Abschlussarbeit schreiben muss kein Mysterium sein. Ja, sie ist anspruchsvoll – aber mit einer klaren Struktur, einem schlüssigen Argument und einer realistischen Forschungsfrage hast Du alles, was Du brauchst.
Denk dran:
- Hol Deine Leser:innen ab – mit einem Thema, das zählt.
- Zeig, was die Forschung schon weiß – und was noch offen ist.
- Stell eine präzise, beantwortbare Forschungsfrage.
- Und beschreibe nachvollziehbar, wie Du sie beantworten willst.
Wenn Du Dich an den Vier-Absatz-Plan hältst und die häufigsten Stolperfallen vermeidest, bist Du auf einem richtig guten Weg. Und falls Du das Gefühl hast, Du willst „zu viel“ – atme durch, wähle einen klaren Fokus und vertraue Deinem Konzept. Du musst nicht die Welt retten. Eine gute Abschlussarbeit reicht völlig.
„Ich habe einfach ein sehr, sehr starkes Argument, warum das jetzt irgendwie wichtig ist – ein komplett logischer Aufbau.“
Genauso soll es sich anfühlen: logisch, relevant, machbar. Und das Beste? Du hast jetzt alles an der Hand, um genau das zu schreiben.
Wenn Du magst, fang direkt an: Schreib zu jedem der vier Absätze 1–2 klare Sätze in einem extra Dokument – das ist dein Rohbau. Von dort aus wird der Rest viel leichter.